 Quelle: Pexels/Tim Mossholder
Quelle: Pexels/Tim Mossholder  Quelle: Pexels/Tim Mossholder
Quelle: Pexels/Tim Mossholder Was wächst denn da? – Und wozu?
Bambus
In Asien schon uralte Tradition, in unseren Breiten nun allmählich auf dem Vormarsch – der Bambus. Diese schnell wachsende Pflanze ist vielseitig einsetzbar, ob ganz traditionell als Baustoff oder in Kleidungsstücken, es gibt viele Optionen. Hier siehst du, wozu dieses Gras (!) fähig ist!
 Quelle: Pexels/NipananLifestyle.com
Quelle: Pexels/NipananLifestyle.com Baustoff
In vielen Teilen Asien ist es uralte Tradition, Bambus als Baustoff für Häuser, Boote, Möbel und vieles mehr zu nutzen. So allmählich kommt das Material auch in den westlichen Ländern an zum Beispiel als Parkettboden oder im Möbelbau, denn der Rohstoffe bringt große Vorteile mit sich. Er wächst nicht nur rasend schnell nach, er ist auch leicht und flexibel. Vor Feuchtigkeit-, Pilz- und Insektenbefall muss Bambus jedoch geschützt werden.
 Quelle: Pexels/Artem Beliaikin
Quelle: Pexels/Artem Beliaikin Textilien
Es gibt Bambussorten, die am Tag einen Meter wachsen. Daher ist dieser Rohstoff günstig und nachhaltig, wenn man auf den richtigen Anbau und Transport setzt. Textilien aus Bambus sind sehr atmungsaktiv, schnell trocknend und daher gut geeignet für die Produktion von Socken oder Unterwäsche. Zirka 90 Prozent der Textilien aus Bambusfasern sind jedoch in Wirklichkeit aus Bambuszellulose gewonnenen Chemiefasern – die Bambusviskose. Diese Fasern schmücken sich mit dem Begriff „umweltfreundlich“ und „nachhaltig“, sind es aber wegen ihrer problematischen Herstellung meist nicht. Wer dennoch nachhaltige Bambustextilien kaufen will, sollte darauf achten, dass diese aus mechanisch hergestelltem Bambusleinen und nicht aus Bambusviskose gemacht sind.
 Quelle: Pexels/Tara Winstead
Quelle: Pexels/Tara Winstead Kosmetik
Aus Bambus können so genannte Flavonoide gewonnen werden. Das sind Pflanzenstoffe, die in nahezu allen Nahrungspflanzen vorkommen. Sie werden wegen ihrer Vitamine und Mineralstoffe häufig in Kosmetikprodukten wie in Anti-Falten- oder Sonnencremes genutzt. Flavonoide wirken zum Beispiel zellschützend, antimikrobiell und lindern Entzündungen.
Mais
Vom Teller bis in den Tank: Mais ist super vielseitig. Hier erfährst du, wo dir die Pflanze überall begegnet, aber auch welche Probleme damit verbunden sein können.
 Quelle: Pexels/Tara Winstead
Quelle: Pexels/Tara Winstead Kunststoff-Ersatz
Von Mülltüten über Tragetaschen und Verpackungen für Lebensmittel bis hin zu kompostierbarem Einweg-Geschirr: Das alles gibt es als umweltschonende Variante bereits aus Mais! Bei der Herstellung des kurzlebigen Einweg-Materials wird die Maisstärke in einen vielseitig verwendbaren Kunststoff umgewandelt – der im Unterschied zu normalem Plastik kompostierbar ist. Damit der Mais-Kunststoff auch nachhaltig ist, müsste er zum Bweispiel auf Festivals aber auch getrennt gesammelt werden und dürfte nicht im Restmüll landen. Das ist leider nur selten der Fall.
 Quelle: Pexels/Gustavo Fring
Quelle: Pexels/Gustavo Fring Kraftstoff
Neben Raps und Zuckerrüben ist Mais einer der wichtigsten heimischen Rohstoffe für die Produktion von Biotreibstoff. Damit sind Mais und Co. nicht mehr nur Nahrungs- und Futtermittel: Ein Drittel des Mais, der in den USA angebaut wird, landet nicht auf dem Teller oder im Tierfutter, sondern im Tank. Auch in Deutschland wird dem Kraftstoff zwischen fünf und 10 Prozent Bio-Treibstoff beigemischt – der aus Mais hergestellt sein kann. Das ist jedoch nicht ganz unumstritten, da in einigen Ländern der Mais als Grundnahrungsmittel dient. Weil mehr Bio-Treibstoff im Tank landet, ist auch die Nachfrage nach Mais enorm gewachsen und der Preis damit gestiegen – Menschen müssen also auch mehr Geld für Lebensmittel aus Mais ausgeben, was gerade in ärmeren Ländern ein Problem ist.
 Quelle: Pexels/Karolina Grabowska
Quelle: Pexels/Karolina Grabowska Textilien
Mais hält auch Einzug in die Modebranche – man findet bereits einige Klamotten auf dem Markt, die auf der Pflanze basieren. Mithilfe chemischer Verfahren wird aus den Maiskolben Garn gemacht und daraus wiederum die Textilien. Besonders gut eignet sich der Garn für T-Shirts und Pullover. Aber auch Zurrgurte, Gardinen und Vliessstoffe werden bereits daraus hergestellt. Dabei dient Mais als guter Ersatz für das erdölbasierte Polyester. Für den Anbau des Rohmaterials für ein Kilo Mais-Garn wird außerdem viel weniger Wasser benötigt als für die gleiche Menge Baumwolle.
Hanf
Wenn du jetzt dachtest, der einzige Vorteil von Hanf ist der Joint, den man daraus drehen kann – dann täuschst du dich gewaltig! Hanf hat viele Verwendungsmöglichkeiten, die die meisten gar nicht auf dem Schirm haben:
 Quelle: Pexels/B-roll
Quelle: Pexels/B-roll Säcke, Netze und Seile
Bereits 4000 v. Chr. stellte man in China aus der Hanfpflanze feste Seile, Taue, Textilien und auch das erste Papier her. Auch heute eignen sich die Kurzfasern dieses nachwachsenden Rohstoffs noch immer super zur Herstellung von Säcken, Seilen, Geotextilien und Netzen. Die Industrie setzt jedoch viel lieber auf Plastik. Und warum? Natürlich, es ist billiger. Aber verdreckt auch gleichzeitig unsere Natur und die Weltmeere enorm. Ist das nicht Grund genug, sich endlich wieder auf Hanf zu besinnen und unsere Umwelt zu schonen?
 Quelle: Pexels/Tara Winstead
Quelle: Pexels/Tara Winstead Kosmetik
Zur äußerlichen Anwendung ist Hanföl gut geeignet, weswegen nun immer mehr Kosmetikprodukte mit der Zutat Hanf werben. Die Pflanze versorgt die Haut mit Fetten, Mineralstoffen und Vitaminen. Aber Achtung! Die meisten Unternehmen nutzen Hanf auch als Marketing-Trick, um besonders nachhaltig und umweltbewusst rüber zu kommen. Sowas nennt man Greenwashing. Achte am besten bei den Produkten darauf, dass das Öl mindestens an dritter Stelle der Inhaltsstoffe szu finden ist: Je weiter vorn ein Inhaltsstoff steht, um so größer ist dessen Anteil im Produkt.
 Quelle: Pexels/Tree of Life Seeds
Quelle: Pexels/Tree of Life Seeds Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente
Gerade besonders oft in Drogerie und Co. zu sehen: CBD-Öl. Dieses Öl fällt unter die Nahrungsergänzungsmittel und hat keine psychoaktive Wirkung, da das berauschende THC der Hanfpflanze hier nicht enthalten ist. Das Öl soll entkrampfend, entzündungshemmend und angstlösend wirken. Man kann es ohne Rezept erwerben und zum Beispiel bei Einschlafstörungen nutzen. Hanf wird außerdem chronisch kranken Patienten auch als Medikament verschrieben. In diesem Fall ist aber THC drin und das kann die Schmerzen im Nervensystem lindern, wie sie zum Beispiel nach Strahlentherapien von Krebspatienten auftreten.
Flachs/Lein
Flachs ist vielen Leuten auch als als Lein bekannt. Er ist mit seinen schönen blauen Blüten nicht nur toll anzusehen, sondern auch ein wunderbares Material. Man kann ihn für die verschiedensten Dinge verwenden:
 Quelle: Pexels/Pixabay
Quelle: Pexels/Pixabay Dämmstoff
Flachs kann verwendet werden um Häuser zu dämmen. Es ist ein nachhaltiger und natürlicher Rohstoff, im Gegensatz zu anderen Dämmmaterialien wie Steinwolle oder Styropor. Dämmstoffe aus Flachs schützen in der warmen Sommerzeit gut vor Hitze und im Winter vor Kälte. Außerdem können sie auch Feuchtigkeit aufnehmen. Flachs zeichnet sich durch seine Formbeständigkeit aus, beim Verbauen des Stoffes schrumpft er deswegen nicht. Auch für die Gesundheit ist Dämmung aus Flachs unbedenklich. Dazu kommt, dass Flachs natürliche Bitterstoffe besitzt, welche ihn resistent machen gegenüber Schädlingsbefall.
 Quelle: Pexels/cottonbro
Quelle: Pexels/cottonbro Bettwäsche
Ursprünglich wurde Flachs sehr häufig für die Produktion von verschiedenen Textilien verwendet. Und noch heute ist jedem die Leinenbettwäsche ein Begriff. Für die Herstellung von Leinenstoff werden Flachsfasern verwendet. Auch als Bezug für Bücher, für Klamotten oder als Dekorationsstoff eignet sich Leinen. Im Gegensatz zu Baumwolle ist Leinen strapazierfähiger und stabiler, das macht den Stoff langlebig. Außerdem ist er auch schmutzabweisend und antibakteriell, Baumwolle kann das nicht von sich behaupten. Flachs ist im Anbau relativ anspruchslos, man braucht dafür weniger Dünger und Pestizide. Vor allem aber benötigt er deutlich weniger Wasser als Baumwolle. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind deshalb geringer.
 Quelle: Pexels/JESHOOTS.com
Quelle: Pexels/JESHOOTS.com Material für Autos
Da Flachsfasern sich durch große Festigkeit auszeichnen, lassen sich daraus sogar Materialien für Autos produzieren. Verwendet werden die Fasern für Teile der Innenausstattung und sogar für die Karosserie. Momentan sind solche Autos noch in der Erprobungsphase. Da Flachs viel leichter als Blech ist, wiegen diese Fahrzeuge viel weniger, wodurch sie auch weniger Kraftstoff (oder Elektroenergie) verbrauchen. Die Composit-Materialien aus Flachs können außerdem auch vollständig recycelt werden.
Kork
Kork ist ein sehr bekannter Rohstoff, aber wusstest du, wo er herkommt? Richtig, er besteht aus der Rinde der Korkeiche. Wenn man an Kork denkt, dann denkt man vor allen Dingen an den Verschluss von Weinflaschen. Aber Kork kann noch viel mehr als nur Flaschen verschließen oder als Pinnwand an der Wand hängen. Finde hier heraus, welche Anwendungen Kork noch haben kann:
 Quelle: Pexels/Eva Elijas
Quelle: Pexels/Eva Elijas Als Bodenbelag
Kork eignet sich hervorragend als Bodenbelag. Ein Boden aus diesem Material ist sehr pflegeleicht und hält dazu auch noch viel aus. Kork hat außerdem einen natürliches Wärmereflexionsvermögen und ist dadurch perfekt geeignet für diejenigen unter uns, die gerne barfuß ihren Alltag verbringen. Auch für Haustiere ist Kork kein Problem, Hund und Katze können mit ihren Krallen dem Boden nichts antun und Schlamm, den die Tiere mitbringen, kann man ganz einfach entfernen. Auch die Geräusche der Tiere beim Laufen werden durch den Bodenbelag abgedämpft.
 Quelle: Pexels/Leo Zhao
Quelle: Pexels/Leo Zhao Für den Sport
Auch in der Freizeit bei Spiel und Sport ist Kork der Renner. Viele verschiedene Ballarten, wie zum Beispiel Baseball-Bälle und Badminton-Bälle bestehen teilweise aus Kork. Auch Dartscheiben und die Griffe von Golfschlägern oder Angelruten werden oft aus diesem wunderbaren Rohstoff hergestellt. In diesem Falle weniger wegen der Optik, sondern weil er rutschfest und haltbar ist. Auch Nässe macht dem Material nicht viel aus.
 Quelle: FNR
Quelle: FNR Dämmstoff
Kork erweist sich auch als guter Dämmstoff. Sowohl für Schalldämmung als auch für Wärmedämmung ist der Stoff geeignet. Konkret bedeutet das, dass Kork zum Beispiel im Dach als Aufdachdämmung oder als Zwischendämmung eingesetzt wird. Die Backkork-Platten, die verwendet werden, lassen sich gut verarbeiten, denn sie sind leicht und weich. Die Vorteile gegenüber anderen Dämmstoffen liegen in der hohen Druckbelastbarkeit und Beständigkeit, außerdem nimmt Kork kaum Feuchtigkeit auf.
Baumharz
Man kennt es: Man macht einen Spaziergang im Wald, muss sich nur kurz die Schuhe zubinden, zum Abstützen benutzt man einen Baum und plötzlich ist die ganze Hand unfassbar klebrig. Der Verursacher dieser Klebrigkeit ist wohl in den meisten Fällen Baumharz. Aber natürliches Harz ist nicht nur dafür da, unsere Hände zu verkleben sondern kann sehr viel sinnvoller eingesetzt werden:
 Quelle: Pexels/Karolina Grabowska
Quelle: Pexels/Karolina Grabowska Naturheilmittel
Schon seit langer Zeit wird Baumharz als Naturheilmittel verwendet. Es wirkt desinfizierend und ist damit perfekt für die Heilung von Wunden geeignet. Geeignet sind vor allem die Harze von verschiedenen Nadelbäumen. Das können zum Beispiel Lärchen, Tannen, Fichten und Waldkiefern sein. Baumharz kann dabei helfen, Entzündungen vorzubeugen, Hautprobleme zu linden oder Gelenk- und Muskelschmerzen zu behandeln. Eine Salbe aus Baumharz kann man sogar selbst herstellen! Aber Vorsicht, in den Harzen sind viele ätherische Öle enthalten. Diese Öle können zu allergischen Hautreaktionen führen. Deswegen immer aufpassen bei der Herstellung und Verwendung von selbstgemachten Salben.
 Quelle: Pexels/Skitterphoto
Quelle: Pexels/Skitterphoto Zum Räuchern
Baumharze sind auch zum Räuchern der absolute Hit. Besonders Myrrhe und Weihrauch wurden schon in der Antike verwendet und waren damals auch außerordentlich teuer. Wegen der großen Nachfrage nach Weihrauch sind die dafür verwendeten Baumbestände heute allerdings teilweise von Raubbau betroffen. Deswegen sollte man besser Harze von einheimischen Bäumen zum Räuchern verwenden. Fichte, Kiefer, Tannen und Lärche eignen sich dafür besonders gut. Sollte man das Harz selbst sammeln, muss man aber immer darauf achten, die Rinde des Baumes nicht zu verletzen.
 Quelle: Pexels/Pixabay
Quelle: Pexels/Pixabay Industrielle Anwendung
Baumharz besteht größtenteils aus Kolophonium und Terpentin. Diese Stoffe findet man in den verschiedensten Produkten. Terpentin wird vor allem in Form von Terpentinöl verwendet, es kommt in Ölfarben, Lacken und Harzfirnissen vor. Beliebt ist es auch als Reinigungsmittel. Kolophonium ist bekannt für die Pflege von Geigenbögen, denn nur einkolophonierte Bögen erzeugen einen vernünftigen Ton. Auch im Reifenbau oder bei der der Herstellung von Kleber oder Kunststoffen können aus Baumharz gewonnene Substanzen verwendet werden. Ein richtiger Allrounder!



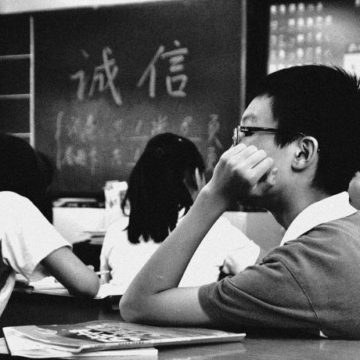











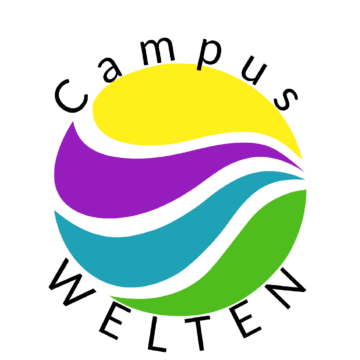







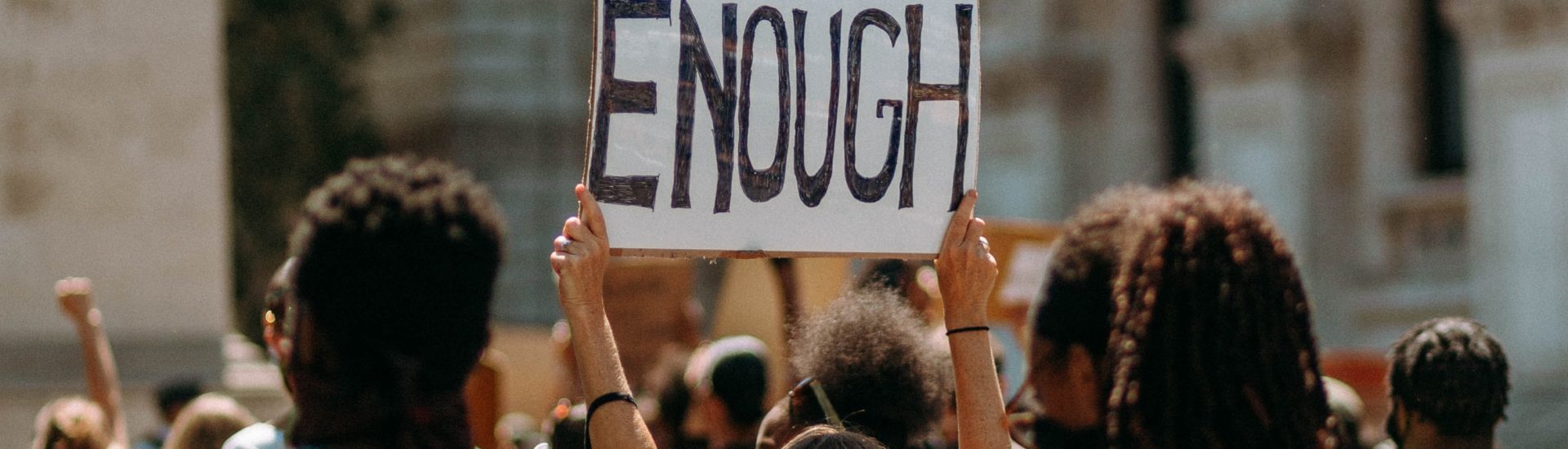



























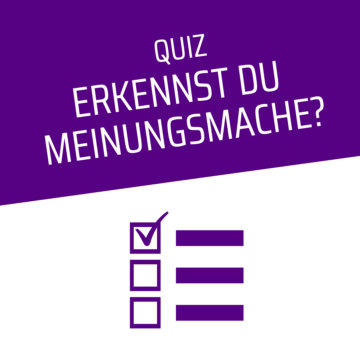




 auseinandergesetzt, sie wurden allgemein als relativ gesund wahrgenommen.
auseinandergesetzt, sie wurden allgemein als relativ gesund wahrgenommen.
 ür Studierende stark verändert. Die Unis blieben geschlossen, was sich für viele neben der Lehre auch auf das restliche Leben auswirkte. Gemeinsam in die Mensa oder ins Café gehen fiel weg, jeglicher Kontakt zu Dozierenden fand über Videokonferenzen und Chats statt. Dazu kamen digitale Prüfungen und finanzielle Sorgen. Dass die Belastung dadurch gestiegen ist, erklärt sich von selbst, wie
ür Studierende stark verändert. Die Unis blieben geschlossen, was sich für viele neben der Lehre auch auf das restliche Leben auswirkte. Gemeinsam in die Mensa oder ins Café gehen fiel weg, jeglicher Kontakt zu Dozierenden fand über Videokonferenzen und Chats statt. Dazu kamen digitale Prüfungen und finanzielle Sorgen. Dass die Belastung dadurch gestiegen ist, erklärt sich von selbst, wie 








